
BMWSB – 2025
Deutschland – allgemein

BMWSB – 2025
Deutschland – allgemein

Sven Bienert, Johann Weiß, Marius S. Dürr (Hg.) – 2025
Deutschland – allgemein

Jennifer Gerend, Marina Beck (Hg.) – 2025
Deutschland – allgemein

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr – 2025
Bayern – Kommune

Universität Stuttgart (Hg.) – 2024
Baden-Württemberg – allgemein

Heid, Andrè – 2024
Deutschland – allgemein

BBSR – 2024
Deutschland – Stadt/Kleinstadt

Handungsempfehlungen für die Belebung von Leerständen in kleinstädtischen und ländlichen Räumen
neuland21 e.V. – 2024
Brandenburg – Stadt/Kleinstadt

Jüngling, Leonard – 2024
Deutschland – allgemein

Janoschka, M. et al – 2024
Baden-Württemberg – allgemein

Das Quadrilemma des steigenden Flächendrucks in ländlichen Räumen
Wüstenrot Stiftung, Neuland21 – 2024
Deutschland – allgemein

Dr. Björn Reith, Dr. Christoph Mayer, Alfred Bauer – 2023
Rheinland-Pfalz – Kommune

Landwirtschaftskammer NRW – 2023
NRW – allgemein

Staatsministerium für Regionalentwicklung – 2023
Sachsen – Kommune

Handbuch für Leerstandsmanager:innen und Gemeinden zur Aktivierung von Leerstand
rus – 2023
Deutschland – Landkreis

Gebäude nach Konzept veräußern. Ein Leitfaden für kleinere Kommunen
Netzwerk Zukunftsorte e.V. – 2023
Brandenburg – Kommune

Baum, Martina et al – 2023
Baden-Württemberg – allgemein

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Würtemberg – 2023
Baden-Württemberg – Dorf

Kulturland Brandenburg Magazin – 2023
Brandenburg – allgemein

Deutscher Städte- und Gemeindebund – 2023
Deutschland – allgemein

difu Deutsches Institut für Urbanistik, Bunzel, A. et al – 2023
Deutschland – Kommune

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hg.) – 2023
Hessen – Kommune

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hg.) – 2023
Hessen – Kommune

Kommunale Handlungspielräume und Entwicklungsperspektiven bei der Aktivierung stadtbildprägender historischer Gebäude
BBSR – 2023
Deutschland – Kommune

Eine Arbeitshilfe für die kommunale Praxis – BBSR – 2023
Deutschland – Kommune

Zukunftsinstitut Wüstenrot Stiftung – 2023
Deutschland – allgemein

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg – 2022
Baden-Württemberg – Kommune

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen – 2022
NRW – Kommune

Potenziale und Werkzeuge der gemeinwohlorientierten Leerstandsentwicklung auf dem Land – Netzwerk Zukunftsorte e.V. – 2022
Brandenburg – Kommune

Schwerpunktthema „Wohn- und Siedlungsentwicklung“
Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft – 2022
NRW – allgemein

Bundesstiftung Baukultur – 2022
Deutschland – allgemein

Reichenbach-Behnisch, Jana et al – 2022
Sachsen – Stadt/Kleinstadt

Beiträge zu Flächenmanagement, Daten, Methoden und Analysen – Eichhorn, Sebastian; Siedentop, Stefan – 2022
Deutschland – allgemein

Bundesstiftung Baukultur – 2022
Brandenburg – allgemein

Hinweise für die Ausarbeitung und Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen
Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr – 2021
Bayern – Kommune

Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen – 2021
NRW – Kommune

complan Kommunalberatung GmbH – 2021
Deutschland – Kommune

Horeldt, Katja; Müller-Hebers, Sabine; Wunder, Barbara – 2021
Bayern – Landkreis

Fahrenkrug, Katrin et al – 2021
Schleswig-Holstein – Landkreis

Flegler, Jonas – 2021
Niedersachsen – Dorf

Scheffler, N. – 2021
Deutschland – Stadt/Kleinstadt

Bundesstiftung Baukultur – 2021
Brandenburg – Kommune

Bundesstiftung Baukultur – 2021
Brandenburg – Kommune

Leerstandsmanagement – Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (Hrg) Gimbel F., Kutschbach C., Kinsky I. – 2021
Thüringen – Landkreis

Integraler Ansatz nachhaltiger Siedlungsentwicklung in schrumpfenden ländlichen Regionen – Schauber, U. – 2020
Thüringen – Landkreis

Stumfol, I., Grinzinger, E., Zech, S., Amann, W., Mundt, A., Leitner, E., Sillipp, N. & Wallenberger, J. – 2021
Deutschland – Kommune

Immovativ – 2020
Deutschland – allgemein

Bayerische Verwaltung für Ländliche Entwicklung – 2020
Bayern – Dorf

Bayerische Verwaltung für Ländliche Entwicklung – 2020
Bayern – Dorf
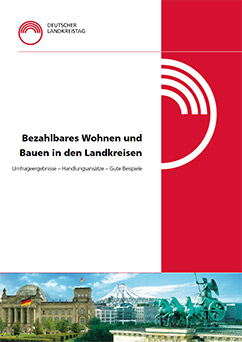
Umfrageergebnisse – Handlungsansätze – Gute Beispiele
Landkreistag – 2020
Deutschland – Landkreis

Lebendige und nutzungsgemischte Wohn- und Versorgungsstandorte in kleineren Städten und Gemeinden
BBSR – 2020
Deutschland – allgemein

Herausforderungen und Lösungen im Quartierskontext
BBSR – 2020
Deutschland – allgemein

Ergebnisse der Umfrage unter Kommunalverwaltungen und Wirtschaftsförderungen
immovativ GmbH – 2020
Deutschland – Kommune

Weitz, S.; Beusker, E. – 2020
NRW – Kommune

Haller, C.; Klinge, W.; Petschmann, H. – 2020
Berlin – Stadt

Funktionsweise, Eignung und Zukunftsfähigkeit alternativer Finanzierungsinstrumente
Kemmler, Linda J. O. – 2020
Deutschland – allgemein

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz Saarland – 2020
Saarland– allgemein

Netzwerk Zukunftsorte e.V. – 2020
Brandenburg – Dorf

Klimaschutzagentur Region Hannover gGmbH, Christiane Dietrich, Wolfgang Kleine-Limberg, mensch und region, Silke Nolting, Kommunale Umwelt-Aktion – 2020
Niedersachsen – Kommune

Erdgeschoßzone Wien – Rusak, S. – 2020
Österreich/Wien – Stadt

Jacuniak-Suda; Marta – 2019
Niedersachsen – Kommune

Braun, Reiner et al – 2019
Deutschland – allgemein

Mensing, Klaus – 2019
Deutschland – allgemein

Gilewski, A.; Haller, C.; Klinge, W.; Peitschmann, H.; von Bodelschwingh, A.; Bela, J.; BBSR (Hrsg.) – 2019
Deutschland – allgemein

Eine Recherche – Bauhaus-Universität Weimar Fakultät, Architektur und Urbanistik – 2019
Deutschland – allgemein

STMELF – 2019
Bayern – Gemeinde

Technische Universität München (Hrsg.) – 2018
Bayern – Dorf
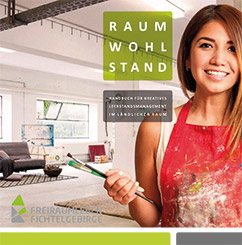
Handbuch für kreatives Leerstandsmanagement im ländlichen Raum
Regionalmanagement Wunsiedel im Fichtelgebirge – 2018
Bayern – Landkreis

Handbuch zur Innenentwicklung – Baukultur Bundesstiftung – 2018
Deutschland – allgemein

BBSR – 2018
Deutschland – allgemein

Wirksame Maßnahmen zur Revitalisierung zentraler Einzelhandelslagen im ruralen Umfeld – Hilpert M., Völkening N., Beck C. – 2018
Deutschland – Stadt/Kleinstadt

Heming, N.; Lüdeling, H. – 2018
NRW – Kommune

Nützliches Instrumentarium oder aussichtslose Anstrengung? Aufwand und Nutzen - Erfolgsfaktoren und Stolpersteine – 2018
Thüringen – Kommune

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – 2017
Hessen – Kommune

Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung – 2017
Brandenburg – Kommune

BBSR – 2017
Deutschland – allgemein

Research Report – Deschermeier P., Henger R., Seipelt B., Voigtländer M. – 2017
Deutschland – allgemein

Lokale Experten berichten aus der Praxis
BMUB – 2017
Deutschland – Stadt/Kleinstadt

Wie Leerstände besser erhoben werden können
BBSR – 2017
Deutschland – allgemein

Bundesstiftung Baukultur – 2016
Deutschland – allgemein

Bundesstiftung Baukultur – 2016
Deutschland allgemein

Regionaler Arbeitskreis Entwicklung, Planung und Verkehr Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler – 2016
NRW – Landkreis

GIS-gestützte Anpassungsmaßnahmen im Demographischen Wandel – Neufeld M., Beyrich L., Burkhardt N., Engl C., Gramann P., Chilla T. – 2015
Deutschland – allgemein

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung – 2014
Niedersachsen – Kommune

Perspektivenwechsel im Umgang mit dem strukturellen Wohnungsleerstand in ostdeutschen Gründerzeitgebieten
Pfeil, A. – 2014
Ostdeutschland – Stadt/Kleinstadt

Krämer, A.-K. – 2014
Bayern – Gemeinde

Analyse aktueller Zensusergebnisse
Rößler, Christian; Hillig, Mandy – 2014
Sachsen – allgemein
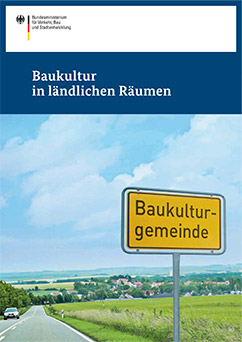
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) (Hrsg.) – 2014
Deutschland – Dorf

Als Impulsgeber in ländlichen Räumen Niedersachsens – Danielzyk, Rainer et al – 2014
Niedersachsen allgemein

So können Dörfer dem demographischen Wandel Paroli bieten – Klärle M. – 2014
Bayern – Dorf

Arbeitskreis Leerstandsmanagement Lippe – 2014
NRW – Landkreis

Website zum Thema Leerstand
Deutschland – allgemein

Mit dem Themenschwerpunkt „großräumige Projekte“ sind wir diesmal nach Brandenburg gefahren. Hier haben wir zwei Projekte besucht, wovon eines kommunal und das zweite privat initiiert sind. Aber um ehrlich zu sein: In beiden Fällen hatten wir es mit gleich mehreren spannenden Umsetzungen zu tun. Die Gemeinde Wiesenburg/Mark und die Gestalter*innen des Alten Postgeländes in Strausberg haben uns von ihren Geschichten berichtet.
Weitere Bereisungen sind in der Planung und wir freuen uns, euch in Zukunft Erfolgsgeschichten vorzustellen!
https://www.youtube.com/watch?v=6WkwtUVM1As
In Mecklenburg-Vorpommern prägen historische Gutsanlagen bis heute das Landschaftsbild. Ihre Geschichte ist bewegt – vom adligen Familiensitz über die Nutzung durch landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften in der DDR bis zur unsicheren Wendezeit. Ende September haben wir zwei besondere Beispiele besucht, die heute durch das Engagement vieler Akteur*innen besondere Ankerpunkte für den Landtourismus darstellen und sich zu Zukunftsorten für nachhaltige Landwirtschaft, Innovation, regionale und kulturelle Entwicklung entwickelt haben.
Weitere Bereisungen sind in der Planung und wir freuen uns, euch in Zukunft Erfolgsgeschichten vorzustellen!
https://www.youtube.com/watch?v=hF93BX5twhQ
Bleiben Sie auf dem Laufenden über erfolgreiche Praxisbeispiele, Veranstaltungen, Förderprogramme rund um Leerstandaktivierung und Innenentwicklung.
Es werden technisch notwendige Cookies eingesetzt, um die Funktionalität der Website zu gewährleisten. Desweiteren werden optionale Cookies eingesetzt, die Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs speichern und verarbeiteten können. Wenn Sie diesen nicht zustimmen, können bestimmte Funktionen beeinträchtigt sein.